Wie ist unser Gehirn gestrickt?
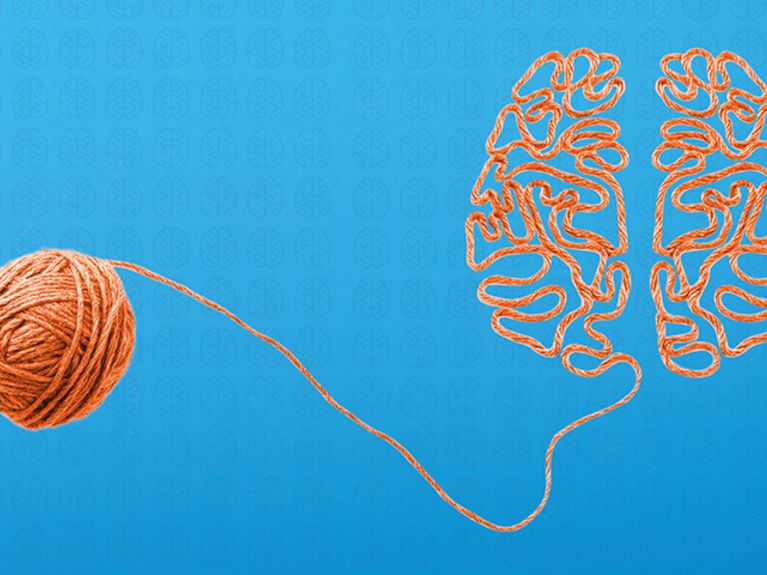
Seit Generationen versuchen Wissenschaftler, dem menschlichen Gehirn auf die Spur zu kommen. Stück für Stück entschlüsseln sie seine Funktionsweisen. Forscher aus Jülich haben nun die Gehirne von rund 1.300 Menschen gründlich untersucht – und nehmen vor allem die Alterung des Hirns in den Blick.
Ihre Probanden hat sie nicht geschont: „Merken Sie sich folgende Begriffe“, lautete die Aufgabe auf einem Zettel mit etlichen Wörtern, und nach einiger Zeit fragte ein Studienmitarbeiter die Begriffe ab. Dann, nach wiederum langem Warten, kam die erneute Nachfrage: Was ist jetzt noch in der Erinnerung geblieben? „Ein klassischer Gedächtnistest“, sagt Svenja Caspers vom Forschungszentrum Jülich, die die Studie mitentwickelt hatte. Die eigentliche Besonderheit ist die Kombination der Tests mit anderen Untersuchungen: Aufmerksamkeitstests, motorische Übungen, Kernspintomografieaufnahmen des Gehirns, dazu seitenlange Fragebögen zum Lebensstil und zur Lebenssituation sowie Laboruntersuchungen.
„Von 2001 bis in die Gegenwart ist da ein unfassbarer Datenschatz zusammengekommen“, sagt Svenja Caspers, die mit Kollegen jetzt daran arbeitet, diesen Schatz zu erschließen. 1.000-Gehirne-Studie heißt das spektakuläre Projekt, von dem sich die Hirnforscher weitreichende Erkenntnisse versprechen: Es könnte zu einem der Mosaiksteinchen werden, die Wissenschaftler seit Jahrzehnten in mühevoller Kleinarbeit aufdecken, um das große Ganze zu erkennen. Mediziner, Neurowissenschaftler, Biologen und Psychologen nähern sich dem Gehirn von verschiedenen Seiten, um seinen Funktionsweisen auf die Schliche zu kommen. Sie studieren haarfeine Schnitte von Gehirnen, sie messen die Aktivitäten und Verknüpfungen verschiedener Hirnregionen, sie untersuchen das Verhalten und die Lernfähigkeit von Affen und Tauben und versuchen, das Gedächtnis und das Vergessen gleichermaßen zu verstehen – aber trotzdem: „Das Gehirn mit seinen verschiedenen Organisationsebenen von der einzelnen Nervenzelle bis zu den großen Netzwerken von Gehirnregionen ist eines der komplexesten Organe des Menschen“, sagt Svenja Caspers. „Und wenn im Gehirn eines Patienten irgendetwas nicht mehr funktioniert, kann man derzeit häufig nicht oder nur unzureichend helfen. Es fehlt selbst das Grundlagenverständnis.“
Svenja Caspers leitet die Arbeitsgruppe Konnektivität am Institut für Neurowissenschaften und Medizin des Forschungszentrums Jülich. Sie ist zudem die Direk-torin des Instituts für Anatomie I an der Universität Düsseldorf. Bild: Forschungszentrum Jülich/Sascha Kreklau
Die Stelle, an der die Medizinerin und ihre Kollegen der Universitäten Düsseldorf, Basel und Duisburg-Essen mit der 1.000-Gehirne-Studie ansetzen, ist das alternde Gehirn. Wenn im Alter die signifikantesten Veränderungen auftreten, so ihre Hypothese, müssten sich doch daraus Rückschlüsse ziehen lassen auf die generellen Funktionsweisen – und darauf, welche Faktoren außerhalb des Kopfes Einfluss haben auf das Gehirn. Dazu wurde eine noch nie da gewesene Fülle von Daten zusammengetragen: Es sind gezielt ältere Menschen untersucht worden, die zu Beginn im Jahr 2001 zwischen 45 und 75 Jahre alt waren und über mehr als anderthalb Jahrzehnte hinweg begleitet wurden. Zudem wurde nicht nur das Gehirn betrachtet, sondern auch die gesamte Lebenssituation der Probanden. Die 1.000-Gehirne-Studie ist eine Fortsetzung der Essener Heinz-Nixdorf-Recall-Studie, in der Patienten mit einem besonderen Blick auf das Herz-Kreislauf-System untersucht wurden. Daten zu Umwelteinflüssen, zur Genetik und etlichen weiteren Faktoren wurden erhoben, alle paar Jahre erhielten die Probanden zusätzlich Fragebögen zu ihrer persönlichen Situation, zu ihrem Beruf, zu ihrer Freizeitgestaltung, zu ihrem Verhalten. Nun wurden die gleichen Probanden noch jeweils einen Tag lang zusätzlich untersucht, diesmal mit speziellem Fokus auf das Gehirn.
„Wir haben vier verschiedene Lebensstilfaktoren in jedem einzelnen Probanden zusammen betrachtet, nämlich Rauchen, Alkoholkonsum, sportliche Aktivität und soziale Integration“, erläutert Svenja Caspers. Sie fand heraus: Sport, soziale Kontakte und Alkohol wirkten sich direkt auf die Gehirnstruktur aus. Rauchen hingegen beeinflusst weniger die Gehirnstruktur, sondern vielmehr die Kommunikation der Gehirnregionen untereinander. Aber: Ist dieses Ergebnis tatsächlich überraschend – dass also Rauchen und Alkohol eher ungesund, Sport und soziale Kontakte eher gesund sind? Svenja Caspers schüttelt den Kopf. Überraschend sei es nicht gewesen, aber es sei eben auch nicht so banal, wie es auf den ersten Blick vielleicht wirke. Denn in der Studie ließ sich erstmals ein Zusammenwirken der einzelnen Faktoren nachweisen, die bislang – wenn überhaupt – getrennt untersucht wurden.
„Generell versucht ein alterndes Gehirn, seine verloren gegangene Leistung zu kompensieren, indem es andere Bereiche des Gehirns mit hinzuzieht, die für die konkrete Aufgabe eigentlich nicht zuständig sind.“
Zudem sei jetzt die Tür geöffnet zu einer ganzen Reihe von Folgeuntersuchungen: Wie viel Schaden richten welche Faktoren im Gehirn konkret an? Und lässt er sich kompensieren durch gesundes Verhalten in einem anderen Bereich? Daraus ergeben sich dann weitere denkbare Zusammenhänge, zum Beispiel zur Konnektivität im Gehirn. Das ist eine der Fragen, denen sich Svenja Caspers am liebsten widmet. „Generell versucht ein alterndes Gehirn, seine verloren gegangene Leistung zu kompensieren, indem es andere Bereiche des Gehirns mit hinzuzieht, die für die konkrete Aufgabe eigentlich nicht zuständig sind“, erläutert sie. Das Gehirn sucht sich also Hilfe: Während ein junger Mensch drei oder vier Gehirnregionen für eine Rechenaufgabe benötigt, kann ein älterer Mensch die gleiche Aufgabe auch problemlos lösen – bei ihm aber muss sich das Gehirn noch Ressourcen aus anderen Hirnbereichen hinzuziehen. „Wenn die Aufgaben jetzt immer schwieriger werden“, sagt Svenja Caspers, „hat der ältere Mensch also eher Probleme als der jüngere, weil er nicht mehr so viele Reserven hat.“ Und damit beginnen für sie die interessanten Forschungsfragen: Wie funktioniert das Zusammenspiel der Gehirnregionen? Wie sind sie miteinander verkabelt? Unter welchen Bedingungen und in welchem Maße kann das Gehirn seine alters- oder krankheitsbedingten Verluste ausgleichen? „Plastizität“ nennen die Hirnforscher diese ganz besondere Fähigkeit des Gehirns, sich ständig zu entwickeln, umzubauen, anzupassen.
Dieser faszinierenden Eigenschaft ist auch Wolf Singer auf der Spur. Er ist Gründungsdirektor des gerade neu entstandenen Frankfurter Ernst Strüngmann Instituts. Der 77-Jährige gilt als Doyen dieses Forschungsbereichs in Deutschland. Am Anfang der Hirnforschung herrschte noch das Bild der Reiz-Reaktions-Maschine vor: Die Augen oder Ohren nehmen einen Reiz auf, der in neuronale Erregung umgewandelt wird, bis am Schluss eine motorische Reaktion herauskommt. So sei es aber gewiss nicht, das wisse man inzwischen, sagt Wolf Singer. Stattdessen sei im Gehirn ein riesiger Schatz an Vorwissen gelagert, der ähnlich funktioniere wie ein Filter, über den alle Wahrnehmungen permanent interpretiert, geordnet und verarbeitet werden. Wolf Singer spricht von „extrem komplexen, raumzeitlich strukturierten Wolken von neuronaler Aktivität“ – ein ungeheures Netzwerk, in dem Informationen verarbeitet werden und das sich mit jeder neuen Information neu zusammensetzt. Klingt abstrakt? Wolf Singer veranschaulicht es mit einem Beispiel: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten drei unabhängige Pendel. Deren Schwingungen lassen sich mit einem einfachen mathematischen Formalismus berechnen“, sagt er – und setzt an zum nächsten Schritt: „Wenn Sie die drei Pendel mit einem Gummifaden koppeln, sodass sich deren Schwingungen gegenseitig beeinflussen, dann entsteht eine hochkomplexe nichtlineare Dynamik, die sich mathematisch nicht mehr fassen lässt. Ähnlich verhält es sich mit der Dynamik neuronaler Netzwerke – nur dass wir da nicht von drei Neuronen reden, sondern von vielen Milliarden Neuronen, die alle untereinander verkoppelt sind. Die Netzwerke in unserem Gehirn entwickeln eine Dynamik, deren Komplexität wir uns schlicht nicht vorstellen können.“
„Die Netzwerke in unserem Gehirn entwickeln eine Dynamik, deren Komplexität wir uns schlicht nicht vorstellen können.“
Trotz der Komplexität dringen die Hirnforscher immer weiter vor auf der Suche nach den Geheimnissen dieser Dynamik. Thomas Wolbers setzt dafür auf ein spezielles Hilfsmittel: Der Psychologe leitet in Magdeburg die Arbeitsgruppe Altern und Kognition am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) – und setzte bei einem Forschungsaufenthalt in Kalifornien zum ersten Mal eine Virtual-Reality-Brille auf. „2006 war das, die Brille war groß, schwer und hatte eine schlechte Auflösung“, erinnert sich Thomas Wolbers und lacht. „Ich weiß noch genau, dass man in der Simulation durch einen Pariser Bahnhof laufen konnte.“ Trotz aller Mängel der neuen Technik war der Psychologe sofort elektrisiert: Er erkannte gleich, dass diese Virtual-Reality-Brillen der perfekte Turbo für seine Forschung sein würden.
Sein großes Thema ist die Navigation. Er sucht nach den Mechanismen, mit denen sich das menschliche Gehirn im Raum orientiert. Für ihn ist das ein Bereich, der als Schlüssel dienen kann – als Türöffner zum tieferen Verständnis des gesamten Denkens. Vordergründig orientiert sich der Mensch anhand von visuellen Reizen; er merkt sich, dass es in seinem Heimatort hinter der Kirche rechts zum Metzger geht und dass bei seinen Freunden die Gästetoilette neben der Treppe untergebracht ist. Aber dann gibt es noch ein hochkomplexes System von Orientierungszellen, die selbst bei kompletter Finsternis registrieren, ob man sich nach vorne oder hinten bewegt, in welchem Winkel man sich dreht und so weiter.
Eine zentrale Funktion übernehmen sogenannte Gitterzellen, für deren Entdeckung 2014 der Nobelpreis verliehen wurde. Sie bilden im Gehirn eine Art Bezugssystem für die räumliche Orientierung. Beheimatet sind sie in einer Gehirnregion namens entorhinaler Cortex. „Das Spannende ist: Genau dieser entorhinale Cortex ist bei Demenz besonders früh betroffen“, sagt Thomas Wolbers. Er folgert daraus zweierlei: Erstens müsste es doch möglich sein, Demenzen mithilfe von Orientierungstests schon zu diagnostizieren, bevor die Patienten sie im Alltag selbst bemerken. Und zweitens müssten sich diesem offenbar besonders sensiblen Bereich des Gehirns Geheimnisse entlocken lassen, die Rückschlüsse auf das Funktionieren des Gedächtnisses zulassen.
Ein Proband versucht, sich in einer virtuellen Realität zurechtzufinden. Bild: Sarah Kossmann
In Magdeburg haben Thomas Wolbers und seine Kollegen dafür ein riesiges Bewegungslabor eingerichtet. Es besteht im Wesentlichen aus einem leeren Raum – in ihm können sich Probanden frei bewegen, auf dem Kopf eine Virtual-Reality-Brille. Fast im Monatsrhythmus führen die Forscher neue Experimente ein, für die Probanden durch virtuelle Aufgaben geschickt werden. Manchmal sollen sie einem Heißluftballon im Zickzackkurs durch den Raum folgen – und am Schluss versuchen, selbstständig an ihren Ausgangspunkt zurückzufinden. Beim nächsten Mal können sie dank der virtuellen Realität durch eine Stadt laufen, die sie noch nicht kennen, und sollen sich dabei Gebäude und Orte einprägen. Diese Experimente machen Thomas Wolbers und sein Team mit jungen und mit älteren Probanden. „Seinen Höhepunkt erreicht das Gehirn irgendwann mit Mitte 20“, sagt Thomas Wolbers, „danach geht es abwärts.“ Bei seiner Forschung steht die Frage im Mittelpunkt, wie genau sich das Altern auf das Gehirn auswirkt.
Es ist die gleiche Frage, die auch Svenja Caspers antreibt, die mit der 1.000-Gehirne-Studie versucht, die Antwort an einer anderen Stelle zu finden. Stück für Stück setzen die Forscher so aus unterschiedlichen Richtungen das Mosaik zusammen, aus dem sich schließlich ein Bild des ganzen Gehirns ergeben soll – und das es eines Tages vielleicht ermöglicht, das Gehirn länger jung zu erhalten.
HUMAN BRAIN PROJECT
Neben der 1.000-Gehirne-Studie arbeiten Forscher des Forschungszentrums Jülich auch an einem der derzeit größten neurowissenschaftlichen Projekte weltweit: dem Human Brain Project. Es wurde 2013 als eines von zwei sogenannten EU-Flagship-Projekten der Europäischen Kommission gestartet. Ziel des Projekts ist es, das komplette menschliche Gehirn detailgetreu von der einzelnen Zelle bis hin zur Interaktion großer Zellverbände und Hirnareale auf einem Supercomputer der Zukunft zu simulieren. Die Forscher wollen so das Gehirn besser verstehen, um Krankheiten künftig früher diagnostizieren und gezielter therapieren zu können. Insgesamt sind Forscher der Neurowissenschaften, Medizin, Informatik, Physik und Mathematik von mehr als 135 renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen aus 23 Ländern an dem Projekt beteiligt – darunter auch Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sowie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).
"Das Denken lässt sich aus zwei Richtungen erkunden" - Der Bochumer Gehirnforscher Onur Güntürkün erzählt über seine Versuche mit Tauben – und darüber, warum neben Medizinern und Biologen auch Psychologen nötig sind, um das Denken zu entschlüsseln.
Leser:innenkommentare