Porträt
Der DNA-Künstler
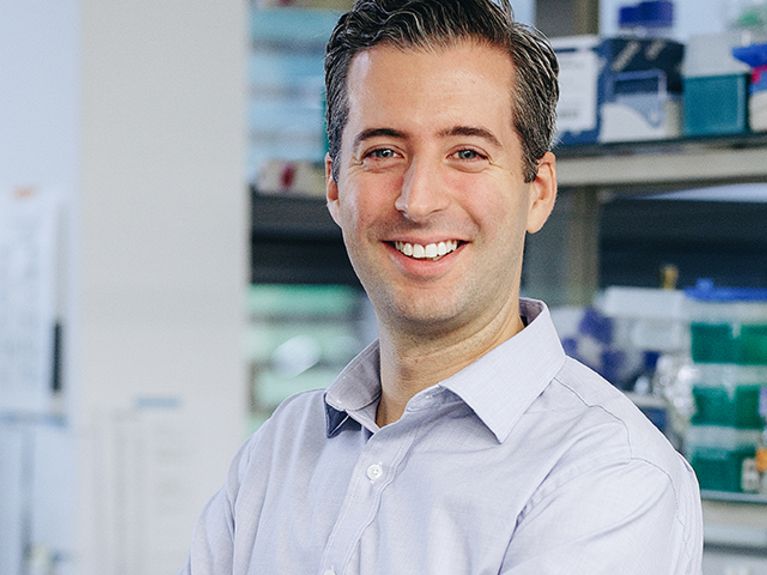
Anton HenssenKrebsforscher am Max-Delbrück-CentrumBild: Linda Ambrosius
Anton Henssen untersucht am Max-Delbrück-Centrum seltene Tumore, praktiziert als Kinderarzt – und ist nebenher Konzeptkünstler. In seine Gemälde bringt er weit mehr von sich ein, als der Betrachter ahnt.
Was für ein Gewusel auf der Leinwand. Rote und blaue Streifen, grüne und türkisfarbene, alle scheinbar zufällig über die Leinwand verteilt: Vom weißen Hintergrund ist kaum noch etwas zu sehen. Sieht aus wie ein Urwald. Ein Dickicht aus Farben. Hat da einer seinen letzten Dschungeltrip aufs Gemälde gebannt? Oder einen bizarren Traum?
Nicht ganz, sagt Anton Henssen. Zum Werk habe ihn inspiriert, was er in seinem zweiten Leben, seinem Hauptberuf, ständig auf Computerbildschirmen betrachte: kreisförmige Diagramme, „Circos Plots“ genannt. Mit denen lassen sich Veränderungen des menschlichen Genoms visualisieren. Jeder farbige Bogen steht dabei für ein Chromosom, das sich bei gesunden Menschen eigentlich an einer ganz anderen Stelle der DNA befinden sollte. Die Zellen, die Anton Henssen auf Bildschirmen betrachtet, sind Tumorzellen. Und seine Diagramme deshalb oft extrem bunt.
Anton Henssen ist Krebsforscher, Spezialgebiet: seltene Tumorarten bei Kindern. Seit Ende vergangenen Jahres leitet er die Emmy-Noether-Forschungsgruppe „Genomische Instabilität bei kindlichen Tumoren“ am Experimental and Clinical Research Center (ECRC), der gemeinsamen Einrichtung des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) und der Charité in Berlin-Buch. Hier will der 33-Jährige herausfinden, wie Besonderheiten im Erbgut dafür sorgen, dass Krebs so früh auftritt. Gleichzeitig arbeitet er als Arzt an der Charité – in der Abteilung für Kinderonkologie behandelt er genau die Fälle seltener Krebserkrankungen, die er durch seine Forschung besser verstehen möchte.
Und noch mehr: Anton Henssen ist auch Konzeptkünstler und Maler. Diesen Sommer hatte er eine Einzelausstellung in der Alten Münze in Berlin-Mitte. Zur Vernissage lud er auch Forscherkollegen. Manche waren verwundert. Eine Frage, die Henssen öfter hört, lautet: „Reicht dir denn dein Beruf nicht aus?“ Na, so darf man es nicht sehen, sagt er dann immer. Forschung und Kunst sind für ihn keine Alternativen. Schon mal gar nichts, was sich ausschließt. „Sie ergänzen sich, bereichern und inspirieren einander.“ Nicht bloß in Form der bunten Bögen, die am Ende auf seinem Gemälde landen.
Zum Malen zieht es ihn in sein Atelier in Berlin-Mitte. Ein ehemaliges Fabrikgebäude, dritter Stock, den Gang durch hinten rechts. In einer Ecke des kahlen Raums steht ein massiver Holztisch mit zahlreichen Sprühdosen darauf. An den Wänden des Ateliers finden sich überall Farbspuren seiner letzten Werke. Durchs Fenster blickt Anton Henssen runter in den Innenhof. Das Arbeiten hier, sagt er, habe viel Meditatives. „Meistens werden Bilder besser, wenn man nicht zu viel darüber sinniert.“ So komme es vor, dass seine Gedanken beim Malen abschweiften und ihm dann plötzlich einfalle, wie dieses eine Problem, das ihn im Labor seit Tagen quält, vielleicht doch zu bewältigen sei. Und umgekehrt starre er als Forscher auf Mutationen und denke sich: Nanu, das sieht jetzt so interessant aus, vielleicht sollte ich einmal versuchen, diese Umrisse zu malen. Er sagt: „Ich arbeite am besten, wenn ich nicht nur einer einzigen Sache nachgehe.“
Die Gleichzeitigkeit von Kunst und Naturwissenschaft galt für ihn schon immer. Seine Schwester Clara erzählt, er habe in der Schule ständig vor sich hingezeichnet, auch in Fächern, wo das nicht zum Lehrplan gehörte. Seine Hausaufgabenhefte seien voller gemalter Tatzen und Entenschnäbel gewesen. Im Nachhinein wundert sich seine Schwester, wie er überhaupt damit durchkam. „Zumindest die Kunstlehrer haben immer zu ihm gestanden.“
Anton Henssen extrahiert zirkuläre DNA aus menschlichem Gewebe. Anschließend verewigt er die unsichtbare DNA mit Ölfarbe, Acryl und Lackspray auf der Leinwand. Bild: Anton Henssen
Anton Henssen ist in Düsseldorf aufgewachsen. Sein Gymnasium lag keine 50 Meter von der Kunstakademie entfernt; jener berühmten Hochschule, an der Joseph Beuys ab den 1960erJahren seine Spuren hinterließ, auch mit seinem Leitspruch: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Die Türen der Akademie standen für alle offen, sagt Anton Henssen, und so ging er schon als Schüler oft hin, sprach Professoren an, zeigte ihnen seine eigenen Gemälde. Leistungskurse: natürlich Kunst und Bio und nach dem Abitur eine schwere Entscheidung. „Ich dachte mir: Wenn ich jetzt Kunst studiere, werde ich nie erfahren, was mich am meisten interessiert: wie sich der Mensch zusammensetzt, und zwar in seinen molekularen Strukturen.“ Also schrieb er sich für Medizin ein, besuchte aber nebenher Vorlesungen der Kunstgeschichte. Hielt auch den Kontakt zur Akademie, feierte dort Partys, tauschte sich mit befreundeten Studenten und Professoren aus.
Er erinnert sich an ein Gespräch, in dem er einem Professor an der Kunstakademie erzählte, er überlege ernsthaft, doch noch komplett zur Kunst zu wechseln. „Um Himmels Willen“, habe der Dozent ihn unterbrochen, „bleiben Sie bloß bei der Medizin. Lernen Sie was Anständiges!“ Er hat den Rat befolgt. Ohne von seiner anderen Leidenschaft zu lassen.
Farben und Formen sind nicht das Einzige, das Anton Henssen aus seinem Forscheralltag in die Kunst einbringt. Den eigentlichen Clou seiner jüngsten Ölgemälde sieht man mit bloßem Auge nicht. Er hat sein eigenes Erbgut in die Farben gemischt. Hat sich im Labor Blut abgenommen, das Röhrchen in die Zentrifuge gestellt, immer wieder Bestandteile herausgefiltert, die er nicht brauchte, so lange, bis am Ende nur noch eine klare, farblose, etwas zähe Flüssigkeit übrigblieb: seine DNA. Die hat Anton Henssen dann in die Ölfarben gerührt – und das Ganze in Schichten auf der Leinwand aufgetragen. Die Beigabe macht optisch keinen Unterschied. „Man kann sagen, ich habe meine Chromosomen in den Bildern versteckt.“
Das Verwenden organischer Substanzen sei kunstgeschichtlich sowieso keine Seltenheit, sagt er: Fasziniert erzählt Anton Henssen von den Höhlenmenschen, die mit eigenem Blut malten, und den Schweineblutorgien des österreichischen Aktionskünstlers Hermann Nitsch oder von Andy Warhol, der auf einige seiner Bilder urinierte. „Bei mir ist es halt zentrifugiertes Erbgut.“ Anton Henssen hat sichtlich Freude daran, die Bezüge und Querverbindungen seiner Kunst aufzuzeigen. Man spürt, dass es für ihn ein reizvolles Spiel ist. Aber auch Wissenschaft.
„Circular DNA“ hieß seine Ausstellung im Juni, die in der Alten Münze in Berlin gezeigt wurde. Das passt zum Schwerpunkt seiner Arbeit. Der Krebsforscher untersucht speziell das Phänomen der zirkulären, also ringförmigen DNA. Seit den 1960er-Jahren ist bekannt, dass DNA-Stränge in Tumorzellen nicht immer linear verlaufen, sondern dass sich dort zwischendrin viele kleine, in sich abgeschlossene Kreise bilden. Vermutlich spielen diese eine zentrale Rolle bei der Tumorbildung – womöglich sind sie gar für das unendliche Wachstum der Zellen verantwortlich. Noch ist dies alles lediglich Theorie. Mittels neuer Sequenziermethoden will er mit seinen Mitarbeitern das Geheimnis der zirkulären DNA entschlüsseln. Und so im besten Fall präzisere Diagnostik oder wirksamere Therapien ermöglichen.
Auch seine Kunst will Anton Henssen weiterentwickeln. Es müsse ja nicht immer das eigene Erbgut sein, sagt er. Womöglich wird er sich bald der Landschaftsmalerei zuwenden. Und ein Naturidyll auf die Leinwand bringen, indem er die DNA jener Pflanzen extrahiert und untermengt, die sich an diesem abzubildenden Ort befinden.
Klar gebe es Unterschiede zwischen seinen beiden Leidenschaften. In der Kunst kreiere er etwas, das vorher nicht war. In der Forschung existiere das Objekt seiner Neugier bereits, er versucht herauszufinden, wie es funktioniert. Also habe er jeweils sehr verschiedene Erwartungshaltungen. Hier baut er auf ein konkretes Ergebnis, dort wartet er ab, was geschieht. Und auf welchem Gebiet fühlt er sich sicherer? „Auf keinem von beiden“, sagt Anton Henssen. „Das wäre auch ein sehr schlechtes Zeichen.“ Unsicherheit sei gesund. Und Triebkraft für alle Neugier.
Weitere Forscherportraits
Leser:innenkommentare