Gendermedizin
Der kleine Unterschied
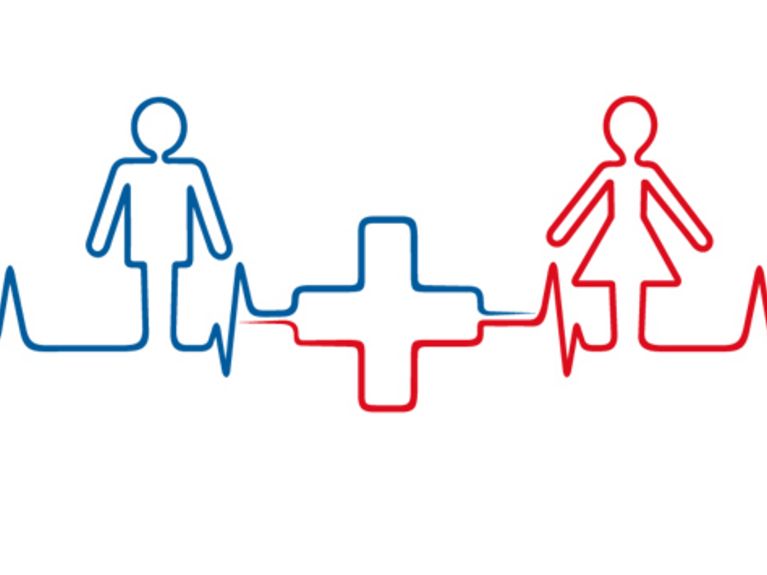
Bild: graphicsdunia/Fotolia
In der Medizin rücken die Verschiedenheiten von Mann und Frau immer stärker in den Fokus. Denn viele Krankheiten haben je nach Geschlecht der Patienten unterschiedliche Ausprägungen.
Es wäre interessant gewesen, in der Ausstellung über ein Forschungsgebiet zu berichten, in dem die Unterschiede zwischen den Geschlechtern tatsächlich eine große Rolle spielen: die Geschlechter- und Gendermedizin. Dieses Feld ist in Deutschland noch jung und wissenschaftlich eher unterbelichtet. Es geht darin nicht nur um soziale und psychologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern auch um unterschiedliche Symptome und Ausprägungen von Krankheiten, die genetisch und biologisch bedingt sind.
„Um solchen Unterschieden auch bei anderen Erkrankungen und bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe noch besser auf die Spur zu kommen, müssen schon in der vorklinischen Grundlagenforschung, bei der Forschung an Mäusen, sowohl weibliche als auch männliche Tiere verwendet werden“, sagt Susanna Hofmann, Professorin für Fettstoffwechselkrankheiten an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und Arbeitsgruppenleiterin am Helmholtz Zentrum München (HMGU). Mehrere Jahre lang forschte sie an verschiedenen Universitäten in den USA. Dort beschäftigt man sich bereits seit den späten 80er Jahren mit Gendermedizin, viele wichtige Studien entstanden dort. Das staatliche National Institute of Health hat die Forschung und Erprobung an männlichen wie weiblichen Organismen bereits zwingend zur Bedingung für die Förderung medizinischer Forschungsprojekte gemacht. Auch die EU hat entsprechende Vorgaben in ihr Forschungsförderprogramm Horizon 2020 aufgenommen. „Mein Eindruck ist, dass das in Deutschland aber noch nicht konsequent umgesetzt wird“, sagt Susanna Hofmann, die am Institut für Diabetes- und Regenerationsforschung (IDR) des HMGU die Arbeitsgruppe „Women and Diabetes“ leitet.
"Das Müsli, das bin ich" - Gendermedizin lebensnah erklärt"
Neben dem Helmholtz-Zentrum leistet auch die Charité in Berlin Pionierarbeit in Sachen Gendermedizin. An der Charité wurde 2007 unter der Leitung von Vera Regitz-Zagrosek das deutschlandweit erste Institut für Geschlechterforschung in der Medizin eingerichtet. Ebenfalls seit 2007 gibt es die von Regitz-Zagrosek gegründete Deutsche Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin (DGesGM) und ihr internationales Pendant (IGM). Beide Gesellschaften weisen immer wieder auf Defizite in Diagnose und Therapie hin, die DGesGM bietet zudem gezielte Fortbildungen für Mediziner an. „Bei weiblichen Patienten machen sich Herzinfarkte seltener als bei Männern durch die bekannten Erkennungszeichen wie etwa Schmerzen im Brustraum, die in verschiedene Körperregionen ausstrahlen können, bemerkbar, sondern sie zeigen häufiger unspezifische Symptome“, sagt die Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek. Zu diesen Symptomen gehören starke Kurzatmigkeit, Übelkeit, Erbrechen oder auch Beschwerden im Oberbauch. „Weibliche Patienten werden deshalb oft zu spät oder falsch diagnostiziert.“
Obwohl sich gerade auf dem Gebiet der Kardiologie in Sachen Gendermedizin schon einiges bewegt habe, fehle behandelnden Ärzten oft das Bewusstsein für diese fatale Kombination, sagt Hofmann. „Für eine sichere Diagnose und Behandlung wäre eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kardiologie und Endokrinologie sehr wichtig – in der Forschung wie in der Therapie. Doch daran hapert es leider noch: Der Kardiologe sucht nur nach Symptomen für Herzerkrankungen, der Endokrinologe schaut auf den Hormonhaushalt.“
Geschlechtsunterschiede bei Diabetes: Frauen leiden zehn Mal häufiger an Autoimmunerkrankungen wie Diabetes. Insulin (weiß) wird von Betazellen der Bauchspeicheldrüse produziert. Bild: Helmholtz Zentrum München
Die Beachtung des Genderaspekts kann im Ernstfall nicht nur Leben retten, sondern „erspart dem Gesundheitssystem unter Umständen auch hohe Kosten, die durch Fehl-Therapien entstehen“, betont Susanna Hofmann. In diesem Sinne spiele die Gendermedizin auch eine wichtige Rolle in der personalisierten Medizin (Interview zum Thema personalisierte Medizin), deren Ziel die punktgenaue, für die Patienten maßgeschneiderte Therapie sei.
Susanna Hofmann und ihr fünfköpfiges Team wollen durch Versuchsreihen an fettleibigen Mäusen herausfinden, worin genau die Stoffwechselunterschiede zwischen Männchen und Weibchen liegen. Sie beobachten unter anderem die Wirkung von Medikamenten gegen Adipositas – und welchen Nebeneffekt sie auf die oft mit Adipositas oder Diabetes einhergehende Fettleberhepatitis haben. „Wir haben festgestellt, dass die Leberentzündung bei Weibchen schneller abnimmt als bei Männchen. Das ist eine wichtige Grundlage für die spätere Entwicklung von Medikamenten für menschliche Patienten.“
Bekannt ist, dass Frauen auf bestimmte Arzneistoffe anders reagieren als Männer, auf Statine zur Cholesterinsenkung etwa oder auf einige Wirkstoffe in Schlafmitteln. Letzteres zeigte sich 2013 bei dem in den USA verbreiteten Schlafmittel Ambien mit dem Arzneistoff Zolpidem. Die für Erwachsene empfohlene Dosierung stellte sich als viel zu hoch für Frauen heraus. Ursache sind geschlechtsspezifische Unterschiede beim Abbau von Zolpidemin der Leber. Deshalb waren Frauen, anders als Männer, am Morgen nach der Einnahme noch immer deutlich verlangsamt in ihrem Reaktionsvermögen. Das war deshalb nicht vorhersehbar, weil Ambien nur an jungen Männern getestet wurde – nicht, weil Frauen bewusst davon ausgeschlossen werden sollten, sondern weil sich vor allem Männer für die Tests zur Verfügung stellten. Mittlerweile wird in klinischen Tests stärker darauf geachtet, auch Frauen einzubeziehen.
Sowohl Susanna Hofmann als auch Charité-Professorin Vera Regitz-Zagrosek begreifen ihre Arbeit als Möglichkeit, die Öffentlichkeit, ihre Kollegen und vor allem auch die nachrückenden Mediziner-Generationen für den Genderaspekt in der Medizin zu sensibilisieren. Im Berliner Medizinstudium ist aus dem anfänglichen Wahlpflicht-bereich Gendermedizin inzwischen ein Pflichtmodul geworden. Auch Susanna Hofmann lehrt an der Münchner LMU zum Genderaspekt bei Fettstoffwechselkrankheiten – allerdings dort nur als Wahlmodul. Beide Professorinnen bestätigen: Das Interesse der Studenten ist groß.
Leser:innenkommentare