Regenerative Medizin
Die Nachmacher
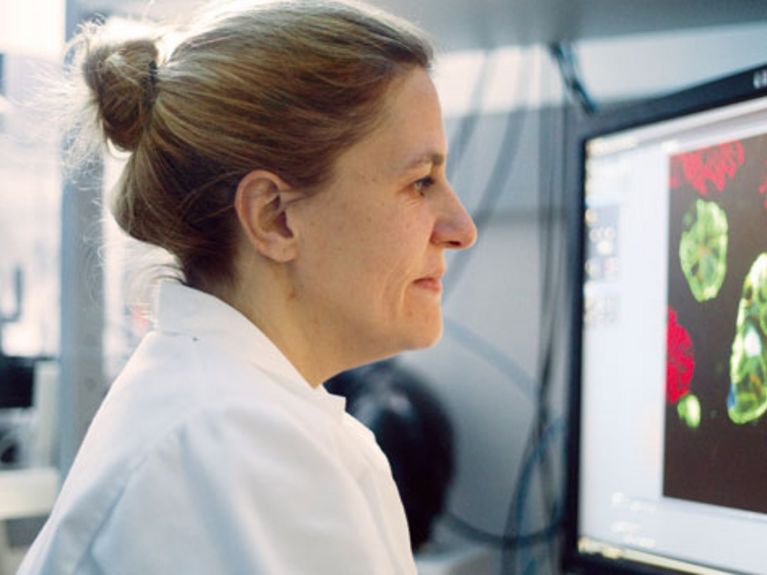
Treibt den Körper an: Francesca Spagnoli möchte die Bauchspeicheldrüse von Diabetes-Patienten mit frischen Zellen in Schwung bringen. Bild: Arne Sattler
Sie beobachten, wie’s der Körper macht – und imitieren die Natur dann in Labor und Petrischale, bauen gar ganze Organe nach. Was mancher gruselig finden mag, begeistert medizinische Forscher: Sie suchen nach neuen Therapien für Krankheiten
Erlebt haben das die Würzburger Biologin Heike Walles und ihre Mitarbeiter. Einen Monat lang hatten sie etwa acht Zentimeter Luftröhre für den Patienten nachgezüchtet. „Wir brauchten dafür Zellen, die sich gut außerhalb des Körpers vermehren lassen“, sagt Walles. „In diesem Fall kamen sie aus dem Oberschenkel des Patienten. Und wir hatten eine passende Trägerstruktur, ein Stück Schweinedarm, das vom Menschen vertragen wird.“ Das Gewebe aus dem Labor hatte sogar ein Blutgefäßsystem, mit dem es an den Blutkreislauf des Patienten angeschlossen werden konnte. Der Körper bildete dann um das Transplantat zusätzliche Zelltypen und wurde dadurch zur Regeneration angeregt. Ein Traum für jeden Zellforscher.
Teile des Körpers im Labor zu züchten, Zellen in der Petrischale zu verändern und dann wieder einzusetzen – das klingt ein bisschen nach Science Fiction. Doch unzählige Wissenschaftler forschen seit Jahren daran, weil sie sich große Heilungschancen für viele Krankheiten versprechen. Erfolge gibt es bislang nicht nur bei Luftröhren, sondern auch Gallenblasen und Epithelzellen der Haut. Auch für die Behandlung von Volkskrankheiten wie Diabetes erhofft man sich Fortschritte. Der Großteil der Arbeit besteht allerdings nicht aus den Erfolgsmomenten – sondern aus mühevollem Separieren, Ausprobieren, Analysieren.
Aus der Hautfabrik: Gewebeschnitt durch ein automatisiert hergestelltes Hautstück. Bild: Fraunhofer IGB
Bei Diabetes sind so genannte Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse betroffen. Sie sollten eigentlich das lebensnotwendige Hormon Insulin produzieren. Weil sie nicht mehr funktionieren, kann der Körper kein Insulin herstellen und den Blutzuckerspiegel nicht regulieren. Patienten müssen das Hormon deshalb spritzen. Eine komplette Bauchspeicheldrüse oder die insulinproduzierenden Teile des Organs zu transplantieren, ist keine realistische Behandlungsmöglichkeit – hauptsächlich, weil es nicht genügend Spender gibt. „Außerdem ist es ein sehr heikles Verfahren, Teile der Bauchspeicheldrüse zu isolieren. Und auch ihre Transplantation ist im Vergleich zu anderen Organen schwierig“, sagt Francesca Spagnoli. Eine Lösung könnten körpereigene Beta-Zellen des Diabetes-Patienten sein, die im Labor gezüchtet werden. Nur wie?
Umstritten: Alexis Carrel hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts Pionierarbeit im Kultivieren von Zellen geleistet, was vielen seiner Zeitgenossen nicht geheuer war. Bild: picture alliance/ Everett Collection
Eine Zelle zu vermehren, heißt jedoch noch lange nicht, dass auch einfach ein neues Organ gezüchtet werden kann. Die Leber etwa besteht aus rund 60 verschiedenen Zelltypen. „Man hat lange Zeit nicht beachtet, wie wichtig die Co-Kultur ist, dass also unterschiedliche Zelltypen gemeinsam gezüchtet werden müssen, da sie sich gegenseitig stimulieren“, sagt die Biologin Heike Walles, die an der Universität Würzburg auch Regenerative Medizin lehrt. Außerdem müssten die Zellen versorgt werden. Auch das sei schwieriger als früher angenommen.
Buntes Treiben: Zellen der Bauchspeicheldrüse eines Mausembryos im Fluoreszenzlicht. Bild: F. Spagnoli/ MDC
Um diese Frage zu beantworten, isolierten Spagnoli und ihre Kollegen im Labor bestimmte Zellen von Mausembryonen. Die in den Zellkernen enthaltene RNA – Kopien des Erbmaterials – lösten sie heraus und untersuchten dann tausende von Genen. „Wir konnten ein Gen identifizieren, das entscheidend dafür ist, ob sich aus einer Vorläuferzelle eine Leber- oder eine Bauchspeicheldrüsenzelle entwickelt.“ Im nächsten Schritt wurden Leberzellen im Labor gezielt zu Vorläuferzellen umprogrammiert, die sich dann schließlich zu neuen Beta-Zellen entwickeln konnten. Mäusen mit Diabetes, denen man diese Zellen einsetzte, produzierten wieder etwas Insulin. „Im nächsten Schritt wollen wir versuchen zu beweisen, dass das Reprogrammieren auch mit menschlichen Leberzellen funktioniert“, sagt Francesca Spagnoli. Ein solcher Erfolg wäre eine gute Basis für neue Therapien: „Leberzellen zu gewinnen ist medizinisch recht einfach“, erklärt Spagnoli. „Man kann eine Biopsie machen und dabei kleine Teile der Leber entnehmen, ohne dem Patienten zu schaden.“ Denn kein anderes Organ könne sich so gut regenerieren wie die Leber.
Brutkästen für Organe: In Bioreaktoren züchtet Heike Walles Gewebe. Bild: Uniklinikum Würzburg, Lehrstuhl TE & RM
Aber auch hier gibt es Grenzen: zum Beispiel bei sehr großflächigen Verbrennungen der Haut, die noch tiefer als die Haarwurzeln reichen. „Dort sitzen die Hautzellen, die die Regeneration anstoßen und die nun nicht mehr funktionieren“, sagt Heike Walles. In einem solchen Fall wird Gewebe aus körpereigenen Zellen nachgebaut – mithilfe so genannter Bioreaktoren. „Man kann sich diese wie eine Kammer vorstellen, die so ausgestaltet sein muss, dass sie alle Reize enthält, die auch im Körper gegeben sind“, sagt Walles. Obere Hautschichten etwa brauchten Kontakt mit der Luft, um zu verhornen.
Die Regenerative Medizin kann schon vieles leisten. Doch Walles, die dem Deutschen Ethikrat angehört, kennt auch die ethischen Probleme, die entstehen können: „Oft sind das teure Behandlungsformen. In einer alternden Gesellschaft könnte es sein, dass nicht alle Patienten solche Therapien bekommen können.“ Diskutiert werden müsse deshalb, wie man dem demografischen Wandel mit den neuen Therapieformen gerecht werden könne. So geht das Deutsche Diabetes-Zentrum davon aus, dass im Jahr 2030 unter den 55- bis 74-Jährigen allein 3,9 Millionen Diabetes vom Typ 2 haben werden – das wären über 1,5 Millionen Patienten mehr als heute.
Kann die Gesellschaft es sich leisten, die Kosten für immer individuellere Therapien für immer mehr ältere Menschen zu tragen? Solche Fragen bringt jeder große Erfolgsmoment in der medizinischen Forschung mit sich – auch bei der Entwicklung von Zellen und ganzen Organen außerhalb des Körpers. Trotzdem geht für Wissenschaftler wie Heike Walles nichts über das Glück, das sich einstellen kann, wenn einem Patienten mit schwieriger Krankheitsgeschichte geholfen werden konnte. Etwa der Mann, der als erster eine Luftröhre transplantiert bekam. Er erzählte Walles nach seiner Entlassung, wie glücklich er sei, weil er nun einfach wieder mit seinem Hund spazieren gehen könne. Heike Walles sagt: „Das war ein bewegender Moment.“
Marc Behl ist stellvertretender Leiter des HZG-Instituts für Biomaterialforschung und leitet die Abteilung Aktive Polymere. Bild: HZG
„Für diese Forschung braucht man einen langen Atem“
Ein Blitzgespräch über Biomaterialien und die Selbstheilung des Körpers mit dem Materialforscher Marc Behl
Gesunde, körpereigene Zellen sind wichtig für die Heilung vieler Krankheiten. Aber auch die Matrix, die die Zellen umgibt, spielt eine große Rolle bei der Gesundung. Eine solche Matrix, eine Art Trägergerüst, kann mittlerweile durch so genannte Biomaterialien nachgeahmt werden. So entwickeln Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) ein selbstauflösendes OP-Netz, mit dem Leistenbrüche verschlossen werden.
Beim Wort „Biomaterialen“ denkt der Laie erst einmal an körpereigenes Gewebe.
Sie aber arbeiten mit künstlichen Polymeren. Wie passt das zusammen?
Ganz allgemein bezeichnet der Begriff Biomaterialien alle Materialien, die in Kontakt mit dem Körper kommen und dafür verträglich sein müssen. Die Polymere bieten den Vorteil, dass sich viele Funktionen einfach integrieren lassen. So können wir polymerbasierte Biomaterialien beispielweise abbaubar gestalten. In Abhängigkeit von der beabsichtigten Anwendung sollen sich manche Materialien von selbst auflösen, nachdem der Körper sich regeneriert hat, andere sollen möglichst lange im Körper bleiben.
Wie schnell können von Ihnen erforschte und entwickelte Biomaterialien bei Patienten angewendet werden?
Die Materialien, die wir entwickeln, sind zwar für den klinischen Einsatz gedacht, werden derzeit aber noch nicht angewendet. Von der Entwicklung bis zur Anwendung des Materials in der Klinik können zehn bis 20 Jahre vergehen. Das liegt daran, dass es sehr hohe Sicherheitsanforderungen an die Materialien gibt, um eine Schädigung der Patienten auszuschließen. Zunächst müssen sie daher mit einfacheren Tests erprobt werden, beispielsweise in Zellkulturen. Dann wird an Tiermodellen die Kompatibilität und Funktionalität untersucht. Erst wenn auch diese Tests erfolgreich waren, können die Materialien klinisch getestet werden.
Wie könnten Biomaterialien Patienten in Zukunft konkret helfen?
Beispielsweise in Form von künstlichen Blutgefäßen oder Stents für Herzpatienten. Allerdings gibt es bei künstlichen Gefäßen mit einem Durchmesser unter vier Millimetern derzeit noch Inkompatibilitäten, die zu Thrombosen führen können. Die Herausforderung ist es, Materialien für künstliche Blutgefäße zu entwickeln, die die Funktionen der natürlichen übernehmen und gleichzeitig von Blutgefäßzellen besiedelt werden. Idealerweise hat sich zu einem späteren Zeitpunkt das Material ganz aufgelöst, während das nachgewachsene Gefäßgewebe die Funktion übernommen hat. Biomaterialien könnten aber auch als Gerüststrukturen dazu beitragen, dass sich Knochen wieder selbst aufbauen, wenn etwa ein Bruch zu groß ist, um von selbst zu heilen. Dann ist ein Gerüst nötig, an dem sich neue Knochenzellen ansiedeln können.
Leser:innenkommentare