Neurobiologie
Auf der Suche nach dem richtigen Weg
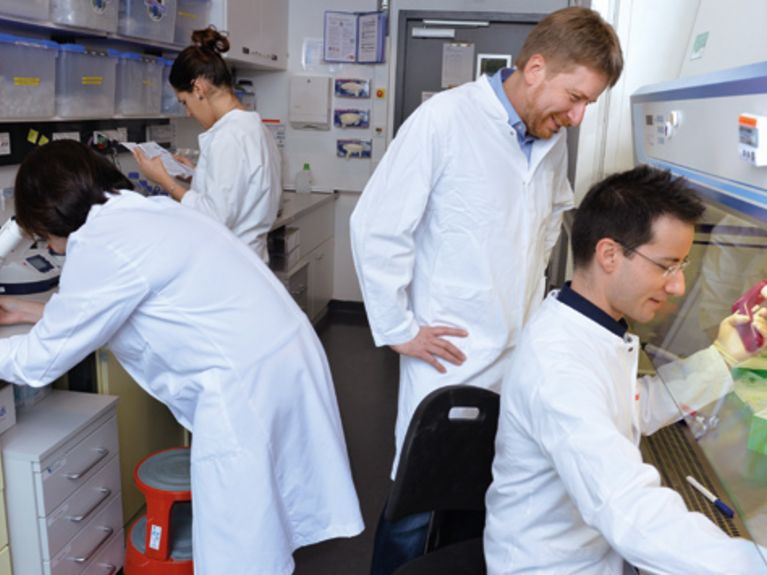
<b>Versuchslabor</b> Das Forscherteam um den Molekularbiologen Frank Bradke (2. v.r.) untersucht, wie Nervenzellen zur Regeneration angeregt werden können. Bild: David Ausserhofer/DFG
Weltweit bemühen sich Forscher, Nervenzellen wieder zum Wachsen zu bringen – um so einmal Schlaganfallpatienten, Querschnittsgelähmten oder Parkinson-Betroffenen zu helfen. Doch warum nur scheint es ein jeder auf andere Art und Weise zu versuchen?
Bild: reined / Fotolia
<b>Prüfender Blick</b> Frank Bradke (links) erforscht mit seinen Kollegen die Eigenschaften von Nervenzellen. Bild: David Ausserhofer/DFG
„Wir versuchen, aus dem Axon eine Art verrückten Autofahrer zu machen, der sich nicht um Stopp-Zeichen kümmert“
Anfangs wollte Bradke einfach nur wissen, warum bei einer Querschnittslähmung die Axone – das sind lange Fortsätze von Nervenzellen, über die die Signale laufen – nicht mehr wachsen. Denn wird ein Axon in Hand, Fuß oder Bein durchtrennt, bildet sich an dieser Stelle ein kleiner Kegel, von dem aus das Axon weiter wächst – doch in Gehirn und Rückenmark bleibt es bei diesem Kegel, ohne dass es zum Wachstum kommt. Der Grund: sogenannte Mikrotubuli – Proteinketten, die normalerweise parallel angeordnet sind und durch ein koordiniertes Vorstoßen das Wachsen veranlassen. Bradke und seine Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn beobachteten, dass diese Mikrotubuli in den beschädigten Rückenmarks-Nervenzellen völlig durcheinandergeraten waren. Mithilfe des Krebsmedikaments Epothilon konnte er die kleinen Röhrchen stabilisieren – und siehe da, die Nervenzellen wuchsen wieder. Seit 1998 forscht er daran. Jetzt erhielt er dafür den begehrten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Will er seine Arbeit Laien erklären, so greift er auch schon mal auf furchtlose Autofahrer zurück: „Wir haben uns gefragt: Was ist der Motor beim Wachsen der Nervenzellen, was die Bremse? Wir haben gesehen, dass es viele Stopp-Zeichen gibt, und selbst wenn man eines entfernt, sind immer noch viele andere da. Deshalb versuchen wir, aus dem Axon so eine Art verrückten Fahrer zu machen, der sich nicht groß um Stopp-Zeichen kümmert.“
Regeneration jederzeit möglich Zebrafische, hier im Karlsruher Institut für Technologie, bilden nach Verletzungen selbst im Gehirn neue Nervenzellen. Bild: Frank Bierstedt/Helmholtz
Auch in einem Bayreuther Keller stehen solche Tanks. In dem gefliesten Raum blubbert und sprudelt es wie in einem Schwimmbad, in sieben Reihen stapeln sich Aquarien übereinander. „Da, diese Fische sind genetisch so verändert, dass sie keine Pigmente bilden können“, sagt Georg Welzel, Post-Doktorand am Tierphysiologischen Institut der Universität Bayreuth. Rötlich schimmern die inneren Organe durch die Haut der kleinen, durchsichtigen Fische. So lassen sich Vorgänge im Inneren am lebendigen Tier beobachten. Viel wichtiger für das Studium der Nervenzellen sind aber die kleinen Fischlarven. Will man sie produzieren, steckt man ein paar Weibchen mit ein paar Männchen in einen Behälter. Am nächsten Morgen legen die weiblichen Fische 200 bis 300 Eier ab, zwei Tage später schlüpfen daraus die Larven. Das Embryonengewebe kann nun durch eine spezielle Flüssigkeit in einzelne Zellen aufgelöst werden. „Wir geben dann kleine magnetische Kügelchen hinzu, die sich nur an die Nervenzellen anheften“, sagt Welzel und hält ein Plastikröhrchen zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe. So werden die Nervenzellen quasi heraussortiert. „Pro Röhrchen bekommen wir etwa 500.000 Stück.“ Legt man dann die Zellen in eine rosafarbene Nährflüssigkeit, kann man ihnen beim Wachsen zuschauen – und beispielsweise in Versuchen herausfinden, was ihr Wachstum fördert oder hemmt.
<b>Dogma widerlegt</b> Magdalena Götz vom Helmholtz Zentrum München hat gezeigt, dass Gliazellen die Vorläufer einer jeden Nervenzelle sind. Bild: Bayer AG
Nicht einfach nur uninteressanter Nerven-Kitt – Gliazellen sind der Ursprung unseres Nervensystems
1995 schaute sich Götz bei einem Experiment an, was ganz zu Beginn der Entwicklung eines Gehirns in den Zellen passiert. Sie erwartete Vorläufer von Neuronen zu sehen und bestimmte Gliazellen. Dann waren da aber nur Gliazellen, sonst nichts. „Ich dachte: Entweder ist die Färbung falsch – oder das Konzept.“ Götz bewies – wie auch andere Forscher –, dass es das bestehende Dogma war, das nicht stimmte. Und sie wies nach, dass alle Nervenzellen einmal Gliazellen gewesen sind. Der so uninteressant scheinende Nerven-Kitt, er war in Wirklichkeit der Ursprung unseres Nervensystems. Das war eine kleine Revolution. Eine weitere folgte, als Götz es schaffte, die Gliazellen in der Zellkulturschale zum Wachsen zu bringen und so Neurone herzustellen – ein Durchbruch. Sie zeigte, dass es lediglich einer Mixtur aus verschiedenen Proteinen bedarf, um das Wachstum anzukurbeln. Lediglich? Hört man Magdalena Götz eine Weile zu, beginnt man zu begreifen, dass natürlich alles viel komplizierter war.
„Es ist absolut wichtig, dass man alle Ansätze verfolgt. Denn verschiedene Krankheiten benötigen auch ganz unterschiedliche Therapien“
Die energische und lebhafte Wissenschaftlerin erzählt, wie nach der Freude über die ersten in der Schale geschaffenen Nervenzellen die Ernüchterung kam: Der Großteil der Neurone starb im Umwandlungsprozess. „Wir hatten gedacht, es sei nur ein kleiner Schritt von der Herstellung einiger Nervenzellen zu vielen tausenden. Tatsächlich sind wir zehn Jahre lang nicht vorangekommen.“ Immer wieder neue Proteine probierte Götz aus, die sie als wichtig für die Entwicklung des Gehirns identifiziert hatte. Immer wieder starben die Zellen. Bis sie mit ihren Mitarbeitern schließlich vor zwei Jahren erkannte: In der Umwandlung einer Glia- zur Nervenzelle findet auch eine Umwandlung des Stoffwechsels statt. In der Natur bildet sich dabei gleichzeitig ein Schutzmechanismus, der die Zelle vor dem Sauerstoff schützt, der im neuen Stoffwechsel produziert wird. In der Zellkulturschale fehlt dieser Schutz – das Neuron stirbt.
Mittlerweile ist diese Hürde genommen, die Umwandlung klappt einwandfrei – jedenfalls bei Zebrafisch- und Maus-Nervenzellen. „Jetzt schauen wir uns an, ob und wie sich die neu gebildeten Neurone dieser Tiere miteinander verknüpfen“, sagt Götz. Mit ihrem 30-köpfigen Team forscht sie an der Universität und am Helmholtz Zentrum München. Im Herbst 2014 erhielt sie für ihre Arbeit den Ernst-Schering-Preis. Götz erzählt auch von Kollegen, die Stammzellen transplantieren, damit diese sich im Gehirn in Nervenzellen umwandeln. Von Hautzellen, die umprogrammiert und dann ebenfalls transplantiert werden. Und nach all dem, den Mikrotubuli, Glia- oder Stammzellen, nach Gesprächen über Axone, Proteine und Moleküle, da drängen sich doch einige Fragen auf: Haben all diese unterschiedlichen Forschungsansätze ihre Berechtigung? Woher wissen, welche Richtung die Richtige ist? Ist dies eine Art Rennen, bei dem nur einer das Ziel erreicht?
Magdalena Götz schüttelt bei dieser Frage sehr energisch den Kopf. „Es ist absolut wichtig, dass man alle Ansätze verfolgt. Denn die verschiedenen Krankheiten benötigen ja ganz unterschiedliche Therapien.“ Nach einem Schlaganfall etwa müssen quasi aus dem Nichts neue Neurone produziert werden, das könnten Gliazellen übernehmen. Bei einer Querschnittslähmung dagegen sind noch Neurone vorhanden und müssen nur wieder zum Wachsen angeregt werden, etwa durch die Stabilisierung der Mikrotubuli. Ganz anders bei Parkinson: Hier sterben die Zellen vollständig ab, dies aber in einer ganz bestimmten Region – eine Transplantation macht dann Sinn.
All diese Krankheiten haben vor allem eines gemein: Das Problem sind die Nervenzellen. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Und so gleicht die Grundlagenforschung zur Regeneration von Neuronen derzeit noch einem großen Gemälde, bei dem an jeder Ecke eine andere Arbeitsgruppe sitzt und malt. Mal fügt der eine beim anderen ein paar Pinselstriche hinzu, mal arbeitet jeder vor sich hin. Vielleicht wird nie ein fertiges Gesamtkunstwerk daraus. Aber vielleicht entstehen viele kleine Bilder, jedes für sich spannend und sinnvoll.
Weitere Informationen zum Thema
Interview: „Ich glaube nicht, dass wir Querschnittsgelähmte in absehbarer Zeit zum Laufen bringen können“
Leser:innenkommentare