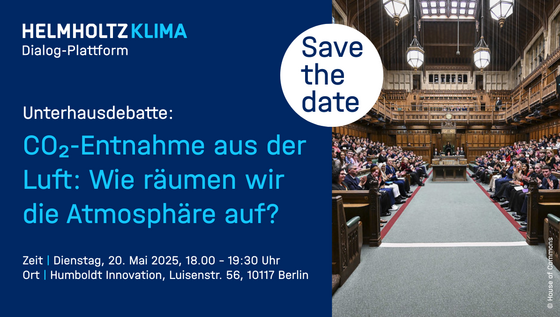|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
wie viel wiegt eigentlich ein Neutrino? Eines dieser rätselhaften Elementarteilchen, die in jeder Sekunde milliardenfach durch uns hindurchfliegen aber so gut wie nie mit Materie interagieren und deshalb unbemerkt bleiben. Zugegeben, auch ich habe mir diese Frage noch nicht allzu oft gestellt. Die Relevanz dieser Information erscheint auf den ersten Blick überschaubar. Nun ist die Bestimmung der Neutrinomasse im Rahmen des KATRIN-Experiments am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gelungen. Und die Schlüsse, die sich daraus ergeben, sind verblüffend. Mehr dazu in diesem Newsletter. Außerdem: Die internationale Wissenschaftscommunity fürchtet um den Zugang zu in den USA gespeicherten Daten. Ein Standpunkt von Susanne Buiter, wissenschaftliche Vorständin des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung. Viel Spaß beim Lesen! |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Neutrinos gehören zu den rätselhaftesten Teilchen des Universums. Sie sind allgegenwärtig, reagieren aber äußerst selten mit Materie. In der Kosmologie beeinflussen Neutrinos die Entwicklung großräumiger Strukturen, während sie in der Teilchenphysik aufgrund ihrer winzigen Masse als Indikatoren für bisher unbekannte physikalische Prozesse dienen. Die präzise Messung der Neutrinomasse ist daher essenziell für ein vollständiges Verständnis der fundamentalen Gesetze der Natur. Genau hier setzt das KATRIN-Experiment mit seinen internationalen Partnern an. KATRIN nutzt den Beta-Zerfall von Tritium, einem instabilen Wasserstoffisotop, um mithilfe der Energieverteilung der entstehenden Elektronen die Neutrinomasse zu messen. Um dies zu erreichen, sind hochentwickelte technische Komponenten notwendig: Das 70 Meter lange Experiment beherbergt eine intensive Tritiumquelle sowie ein hochauflösendes Spektrometer mit einem Durchmesser von zehn Metern. Diese Technologie ermöglicht eine bislang unerreichte Präzision bei der Messung der Neutrinomasse. Mit den aktuellen Daten aus dem KATRIN-Experiment konnten die Forschenden für die Neutrinomasse eine Obergrenze von 0,45 Elektronenvolt/c^2 (das entspricht 8 x 10^-37 Kilogramm) ableiten. Gegenüber den letzten Ergebnissen aus dem Jahr 2022 konnten sie die Obergrenze damit fast um einen Faktor zwei senken. „Unsere Messungen zur Neutrinomasse werden noch bis Ende 2025 andauern. Durch die kontinuierliche Verbesserung des Experiments und der Analyse, sowie durch eine größere Datenmenge erwarten wir eine noch höhere Sensitivität – und möglicherweise bahnbrechende neue Erkenntnisse“, blickt das KATRIN-Team optimistisch in die Zukunft. Schon jetzt führt KATRIN das weltweite Feld der direkten Neutrinomassenmessung an und hat mit den ersten Daten die Ergebnisse früherer Experimente um das Vierfache übertroffen. Das aktuelle Resultat zeigt, dass Neutrinos mindestens eine Million Mal leichter sind als Elektronen, die leichtesten geladenen Elementarteilchen. Diesen enormen Massenunterschied zu erklären, bleibt eine Herausforderung für die Theoretische Teilchenphysik. Neben der präzisen Neutrinomassenmessung plant KATRIN bereits die nächste Phase. Ab 2026 wird ein neues Detektorsystem, TRISTAN, installiert. Dieses Upgrade des Experiments ermöglicht die Suche nach sogenannten sterilen Neutrinos im Kiloelektronenvolt/c2-Massenbereich. Sterile Neutrinos sind bisher hypothetische Elementarteilchen, die nochmals deutlich schwächer interagieren als die bekannten Neutrinos und geeignete Kandidaten für die Dunkle Materie sind. Darüber hinaus wird mit KATRIN++ ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm initiiert, um Konzepte für ein Experiment der nächsten Generation zu erarbeiten, das eine noch präzisere direkte Messung der Neutrinomasse ermöglichen soll.
Chlorotonil: Game-Changer im Kampf gegen multiresistente Keime Sedimentaufwirbelung durch Schleppnetzfang verringert CO2-Aufnahme |
|
Am meisten fasziniert mich die tägliche Zusammenarbeit mit Forschenden, ihre Begeisterung und ihr Antrieb, das Wissen mit der Gesellschaft zu teilen. In der Helmholtz-Geschäftsstelle gestalte ich den wissenschaftlichen Kosmos aus einer horizontalen Perspektive mit: Ich vernetze Disziplinen und Menschen, begleite Prozesse und unterstütze so wissenschaftliche Exzellenz (auf einer infrastrukturellen und strategischen Ebene). Besonders bereichernd finde ich, wenn durch meine Impulse neue Verbindungen zwischen Menschen und Disziplinen entstehen, die neues und überraschendes Wissen erzeugen, das am Ende der Gesellschaft nützt.
Ich würde meine eigene interdisziplinäre Summer School ins Leben rufen. Mit gezielten Stipendien würde ich jungen Wissenschaftler:innen die Teilnahme ermöglichen, um ihnen Mut zu machen, Wissenschaft mit Leidenschaft, Neugier und unkonventionellen Denkansätzen zu gestalten – so wie ich es selbst erleben durfte. Während meiner akademischen Laufbahn hat mich eine Summer School in Woods Hole, einem kleinen Hafendorf an der US-Ostküste, tief geprägt. Dort isolierten internationale Wissenschaftler:innen aller Karrierestufen – darunter sogar Nobelpreisträger:innen – Seite an Seite Proteine aus frisch gefangenen Tintenfischen, die wir später gemeinsam grillten. Beim anschließenden Essen entstanden leidenschaftliche Diskussionen, die oft bis tief in die Nacht andauerten und Raum für radikal neue Ideen schufen. In dieser einzigartigen Kombination aus kreativer Freiheit, offener Geisteshaltung und direktem Mentoring durch außergewöhnliche Persönlichkeiten entsteht eine Atmosphäre, die weit über klassische akademische Formate hinausgeht.
Ich würde gern mit Richard Feynman zu Abend essen – ein brillanter Physiker und begeisternder Lehrer mit viel Humor. Seine einfallsreiche Art, Wissenschaft nachvollziehbar zu erklären, fasziniert mich. Wir würden gemeinsam essen, über sein bewegtes Leben reden und Wissenschaft von heute mit damals vergleichen. Nach dem Dessert würden wir gemeinsam den Tresor des Restaurants knacken – ein Hobby, das er sich während seiner Zeit in Los Alamos aus Langeweile zugelegt hat. |
|
|
|
Kürzungen, Kündigungen, Festnahmen – wir erleben gerade in einigen Staaten weltweit einen Kampf gegen Wissenschaft aus ideologischen Gründen, der an finsterste Zeiten in Europa erinnert. Im Fokus stehen „Wokeness“, „Gender“, Klima und Gesundheit sowie Diversität, Gleichstellung und Inklusion – und sogar Wissenschaft als solche. Ausgerechnet die Regierung der stärksten Wissenschaftsnation der Welt macht bei diesem Kampf an vorderster Front mit. In den USA sind neben der Gesundheitsforschung die Geowissenschaften besonders betroffen, weil Klimawandel und Umweltschutz zu „Un-Themen“ erklärt werden und Programme zur Erdbeobachtung von drastischen Kürzungen oder sogar einem kompletten Aus bedroht sind. Damit sind nicht nur jahrzehntelange Partnerschaften gefährdet, sondern auch wertvolle Datenbestände. Allein der Umweltdatendienst der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA, NOAA, listet Dutzende Datensätze und Produkte auf, die beendet werden. Darunter sind Daten aus Erdbebenkatalogen oder zu Ozeanströmungen. Es drohen Lücken in globalen Messnetzen, die für die Erdbeobachtung und damit für Klimamodelle und Frühwarnsysteme unerlässlich sind. Hinzu kommt, dass wir wissenschaftliche Daten oft arbeitsteilig in internationalen Netzwerken verarbeiten: Sensoren, irgendwo auf der Welt oder im All, liefern Rohdaten, die Partner:innen weltweit aufbereiten und für andere Forschende verfügbar machen. Wir haben die Sorge, dass wichtige Prozessschritte ausfallen. Im Helmholtz-Forschungsbereich Erde und Umwelt diskutieren wir, Speicherkapazitäten, Fachwissen und Schnittstellen gemeinsam zu organisieren, bevor wichtige Daten unwiderruflich verschwinden. Dazu brauchen wir allerdings nicht nur Hardware, sondern auch personelle Kapazitäten. Denn die Prozessierung und die Bereitstellung der Daten zur Wiederverwendung können wir langfristig nicht mit dem vorhandenen Personal stemmen. Wir haben uns zunächst auf eine Auswahl bedrohter Datenbestände verständigt, die wir übernehmen und damit der wissenschaftlichen Gemeinschaft weiter zur Verfügung stellen könnten. Hier helfen existierende Dienste wie PANGEA vom AWI oder GFZ Data Services. Mit einer Erhöhung der Personalressourcen für eine Übergangszeit können wir uns Zeit verschaffen für langfristige europäische Lösungen. Wir brauchen Redundanz ohne unnötige Dopplungen von Datensätzen und die Einbettung in europäische Strukturen. Es gibt bereits Netzwerke und Infrastrukturen wie etwa ERICs (European Research Infrastructure Consortium), die wir ansprechen können. Helmholtz als die größte deutsche Forschungsorganisation sollte hier Vorreiter sein und Wege bahnen, die wir gemeinsam mit anderen Forschungsorganisationen und der europäischen Politik gehen müssen. Dazu müssen wir Ressourcen freimachen oder zusätzliche Mittel einwerben. Massive Kürzungen und Schließungen werden oft mit der Frage gerahmt, welche Art von Wissenschaft man sich denn leisten wolle. Das ist aus meiner Sicht grundfalsch. Wir müssen stattdessen fragen, welche Datenlücken und welches Unwissen wir uns als Gesellschaft leisten können. Und wir müssen darauf hinweisen, was die Folgen dieser Lücken sind. Wir befinden uns als Menschheit in einer Multikrise planetaren Ausmaßes, allein schon, was Biodiversitätsverlust und Klimaerwärmung betrifft. Wir steuern auf Gefahren zu, die nicht verschwinden werden, wenn wir die Augen zumachen. Im Gegenteil. |
|
|
|
|
|
|
|
Forschung: Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in den USA erläutert Otmar D. Wiestler im Interview mit dem Focus (Ausgabe 18/2025), dass derzeit vermehrt Anfragen von Forschenden aus den USA eingehen. Er betont, dass die Helmholtz-Gemeinschaft keine gezielte Abwerbekampagne plane, sondern vielmehr bestehende Programme neu auflegt, stärkt und sichtbarer macht. Diese Programme sollten vor allem auch Nachwuchsforschende ansprechen, die unter anderen Umständen in die USA gegangen wären. Stromausfall: Der Stromnetz-Experte Benjamin Schaefer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) äußert sich auf Spiegel Online zum Blackout auf der iberischen Halbinsel am vergangenen Montag. Er erklärt, warum die großflächige Wiederherstellung des Stromnetzes nur schrittweise erfolgen kann und das Hochfahren von Kohle- und Atomkraftwerken in solchen Extremsituationen besonders herausfordernd ist. Erdbeben: Angesichts der schweren Erdstöße der vergangenen Tage in Istanbul warnen Expert:innen, dass diese Vorboten eines möglichen Megabebens in der Region sein könnten. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erläutert der Geophysiker Marco Bohnhoff vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ) den aktuellen Kenntnisstand zum Erdbeben. Bohnhoff, der seit mehreren Jahren ein Messprogramm in der Region leitet, erklärt, dass es sich bei den jüngsten Erschütterungen um die stärksten seit mehr als 25 Jahren handele. Umweltdaten: Der mdr berichtet, dass mehrere deutsche Forschungseinrichtungen – darunter die Helmholtz-Zentren für Umweltforschung (UFZ), Ozeanforschung (GEOMAR), Geoforschung (GFZ) sowie für Polar- und Meeresforschung (AWI) – aktiv an der Sicherung gefährdeter US-Umweltdaten beteiligt sind. Im Gespräch mit dem mdr erklärt GFZ-Forscher Wolfgang zu Castell, dass sich innerhalb des Helmholtz-Forschungsbereichs Erde & Umwelt eine „Koalition der Willigen“ gebildet habe, die gemeinsam zentrale Ressourcen wie Speicherkapazitäten, technisches Fachwissen und Schnittstelleninfrastrukturen koordinieren. Kaviar: Der Tagesspiegel berichtet über die inzwischen emeritierte AWI-Professorin Angela Köhler, die eine neuartige, international patentierte Methode zur Gewinnung von Kaviar entwickelt hat, ohne dass die Fische dafür getötet werden müssen. Die sogenannte Lebend-Ernte liefert sauberen Rogen, der ohne Konservierung auskommt und besonders mild gesalzen werden kann. Das Verfahren gilt als Meilenstein für mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit in der Kaviarproduktion. |
Herausgegeben von: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Anna-Louisa-Karsch-Str.2, 10178 Berlin Redaktion: Sebastian Grote, Franziska Roeder, Martin Trinkaus Bilder: Phil Dera (Editorial) Noch kein Abo? Hier geht's zur Registrierung Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie einfach hier: Newsletter abbestellen © Helmholtz
|